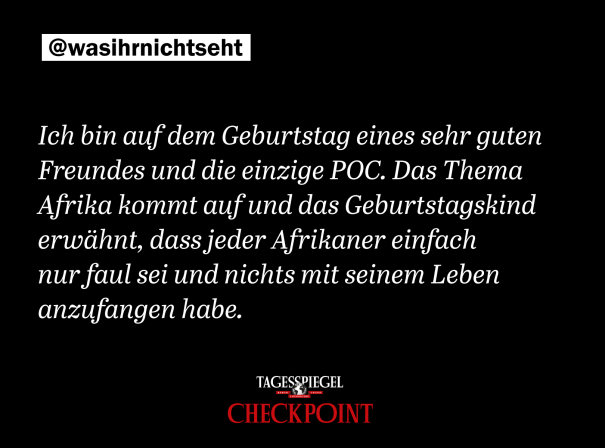| | Guten Morgen,
auf den ersten Blick wirkt der Vorschlag der Berliner Grünenführung für das Amt der Spitzenkandidatin ziemlich surreal: Nicht Wirtschaftssenatorin Ramona Pop soll es machen und auch nicht Fraktionschefin Antje Kapek, sondern Bettina Jarasch, eine weitgehend unbekannte frühere Landesvorsitzende, der die Partei zum Abschied vor knapp fünf Jahren nicht einmal die gewünschte Bundestagskandidatur gönnte.
Dass womöglich keine der beiden bekanntesten und erfahrensten Grünen-Politikerinnen kandidieren würde, hatte sich zwar seit ein paar Wochen wie ein Kriechstrom im Betrieb verbreitet. Doch das erhöhte nur die Erwartungen: Wenn weder Pop noch Kapek antreten würden, wer sollte dann bestehen gegen Franziska Giffey, die designierte Kandidatin der SPD? Wohl doch nur jemand aus der Bundesebene: Cem Özdemir? Der wohnt sogar in Kreuzberg. Annalena Baerbock? Als Brandenburgerin mit Arbeitsplatz Berlin prädestiniert für die vernachlässigten Interessen der Außenbezirke. Vielleicht eine Marke wie Monika Herrmann, die Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Claudia Roth als Knalleffekt. Renate Künast reloaded. Oder wenigstens Lisa Paus, Berliner Bundestagsabgeordnete. Aber doch nicht eine Kandidatin, bei der fast die ganze Stadt fragt: Bitte wer?
Tatsächlich aber haben die Grünen, und hier vor allem Pop und Kapek, ein Manöver eingeleitet, das die Briten als „Duck and Dive“ bezeichnen: Sie wollen auf der Stimmungswelle so unauffällig wie möglich bis ins Ziel surfen. Sowohl Pop als auch Kapek hätten das Gleichgewicht verlieren und vom Brett fallen können – beide bieten zu viel Angriffsfläche: die Wirtschaftssenatorin, den Realos zugerechnet, vor allem in der eigenen, links ausgerichteten Partei, die ihr Wirken misstrauisch bis ablehnend begleitet; die Fraktionsvorsitzende, dem linken Flügel angehörend, in weiten Teilen Berlins, wo nur wenig von der eher kompromisslosen, mehr auf die Innenstadt ausgerichtete Politik der Grünen gehalten wird.
Mit Blick auf mögliche neue Koalitionen wirkt Jarasch im Vergleich zu Pop und Kapek tatsächlich mehr wie die Brückenbauerin, die zu sein sie für sich in Anspruch nimmt – und das gilt auch in der eigenen Partei. So lässt sich zu den vier programmatischen Punkten, die Jarasch als ihre wohlgefälligen Ziele benennt (Verkehrswende und Klimaschutz, bezahlbare Wohnungen und lebendige Quartiere, Sicherung von Arbeitsplätzen und sozialökologische Transformation der Wirtschaft, Bündnisse für Demokratie) ein strategischer fünfter ergänzen: die Entpolarisierung als Mittel, ja: als Mitte zum Zweck. Demnach muss Jarasch gar nicht mit viel Krawall auf sich aufmerksam machen, im Gegenteil: Kein Hai, der ins Brett beißen könnte, soll mehr angelockt werden.
Dass es Pop und Kapek nicht ganz leichtgefallen ist, Platz zu machen, war ihnen bei der Präsentation der Überraschungskandidatin anzumerken – besonders immer dann, wenn Jaraschs tatsächlichen oder vermeintlichen Vorzüge hervorgehoben wurden: „eine, die anpacken kann“; „eine, die führen kann“; „eine, die nicht nur in der Partei wirken kann“. Und schließlich: „Die beste Aufstellung für diese Stadt.“ Als „ein Kunststück“ bezeichnete es Kapek am Ende sogar selbst, „die Individualinteressen zurückzustellen“, und Pop sprach etwas hilflos von „einer Akklamation“, was schon skurril wirkt für eine basisdemokratisch ausgerichtete Partei, der jetzt immerhin eins erspart bleibt: eine alles schwächende Kampfkandidatur.
Die anderen Parteien werden wenig persönliche Attackepunkte finden. Aber ein Nachteil lässt sich durch keine Sonnenblume verdecken: Jarasch hat absolut keine Regierungs- oder Verwaltungserfahrung, und das in einer Stadt, die an ihrer organisierten Unzuständigkeit leidet. Zuletzt war sie in ihrer Partei Sprecherin für Religionsfragen, und das jedenfalls passt – denn ein bisschen beten und dran glauben müssen sie bei den Grünen jetzt schon. | |