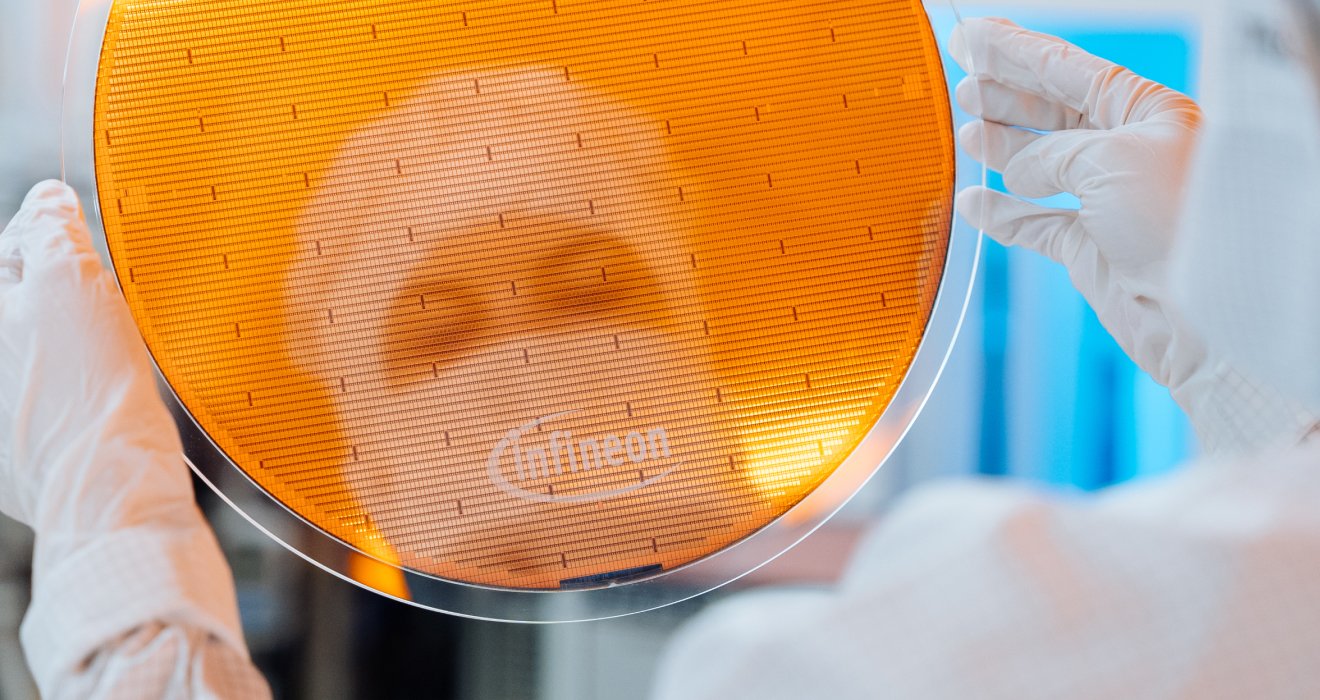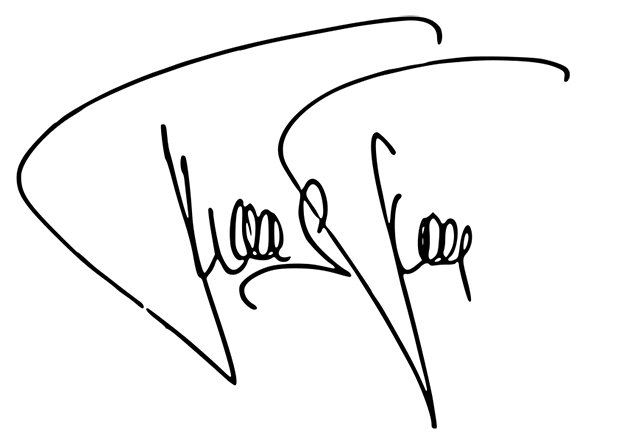| Liebe Leserin, Lieber Leser,
Donald Trump kommt. Die „Wokeness“ geht. Ich schreibe sie pflichtschuldigst in Anführungsstrichen, weil schon die Vokabel zwiespältig bleibt, obwohl das hier eher eine Grabrede wird als eine Provokation.
Für die einen markiert die „Wokeness“ einen notwendig bleibenden Kampf gegen Diskriminierung aller Art. Und glauben Sie mir, ich fühle mich als alter, weißer Mann bisweilen selbst eher unterprivilegiert bis marginalisiert. Für die anderen ist der Begriff eine Chiffre für linke Gängelung, womit wir wieder bei Trump sind, der eindeutig der letzteren Fraktion angehört.
Er war noch gar nicht im Amt, da zogen viele US-Konzerne schon ihren Diversity-Programmen den Stecker: Walmart, Disney, McDonalds, Facebook … Plötzlich merkt man, dass viele der Sensibilitäts-Postulate doch eher billige Marketing-Aktionen waren mit einer Handvoll Regenbogen-Fähnchen vorm Konzernsitz.
Im vergangenen Sommer erlebte dann die Motorradmarke Harley-Davidson für ihre neue woke Hauskultur einen ersten Shitstorm der eigenen Kundschaft, die’s nicht so hat mit Achtsamkeit gegenüber Mikroaggressionen.
Dabei teilt sich das Wokeness-Phänomen in wenigstens drei Gruppen. Erstens: Jedes Geschäftsmodell, das mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz Geld verdient, halte ich weiter für sinnvoll. Ebenso – zweitens – die Kultivierung gewisser Umgangsformen, die uns doch längst klar sind, oder? Man begrabscht keine Frauen, beschimpft keine Minderheiten etc. Drittens brach sich daneben aber zugleich ein beachtlicher Wokeness-Wahnsinn Bahn.
Ich erinnere mich noch gut an die Berliner Spitzen-Grüne Bettina Jarasch, die mal gebeichtet hatte, dass sie als Kind „Indianerhäuptling“ werden wollte. Sie musste sich auf Wunsch ihrer Partei sofort bei allen indigenen Stämmen Amerikas für die postkolonial-rassistische Beleidigung entschuldigen. Seither wartete ich nur darauf, wann die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg ihre Wigwam-GmbH freiwillig dichtmachen würden. |